- Prediction Markets dringen in die Welt der Sportwetten vor.
Plattformen wie Kalshi und Polymarket erlauben Wetten auf Sportereignisse – offiziell als Finanzkontrakte. - Der US-Government-Shutdown legt Aufsicht lahm.
Weil die CFTC kaum handlungsfähig ist, entstehen regulatorische Grauzonen. - Boom trotz Risiko.
Im Oktober verzeichneten Prediction Markets Handelsvolumen von über 7,4 Milliarden Dollar – Rekord. - NBA-Skandal rückt neue Wettformen ins Rampenlicht.
Ein Fall von Spielmanipulation zeigt, wie schwer Kontrolle in diesem Umfeld ist. - CFTC steht unter Druck.
Mit weniger als 700 Beschäftigten soll sie Milliardenmärkte und Sportwetten zugleich überwachen. - Kalshi und Polymarket expandieren trotz Kritik.
Beide Partner der NHL betonen Transparenz durch Blockchain-Technologie. - Branche im Wandel.
Klassische Sportwettenanbieter reagieren nervös – einige, wie DraftKings, steigen selbst in Prediction Markets ein.
Wenn Wetten zu Finanzprodukten werden
Was vor wenigen Jahren noch wie eine Randerscheinung wirkte, ist inzwischen ein Milliardenmarkt: sogenannte Prediction Markets. Nutzer können dort auf den Ausgang realer Ereignisse spekulieren – von Wahlen über Wirtschaftsdaten bis hin zu Sportergebnissen. Im Gegensatz zu klassischen Sportwetten sind diese Plattformen nicht staatlich, sondern bundesweit über die Finanzaufsicht CFTC reguliert. Doch mit dem anhaltenden Government Shutdown steht die Behörde praktisch still. Die Kontrollen sind ausgedünnt, Genehmigungen verzögert, und Plattformen wie Kalshi oder Polymarket handeln trotzdem weiter. Ein ehemaliger Mitarbeiter der US-Aufsichtsbehörde CFTC erklärte gegenüber Decrypt, die Behörde sei zu klein aufgestellt, um den rasant wachsenden Markt der Prediction Markets wirksam zu kontrollieren. Das öffnet Tür und Tor für neue Anbieter – und mögliche Risiken.

Der Government Shutdown als Risiko-Booster
Seit Anfang Oktober ist der US-Haushalt blockiert – und mit ihm weite Teile der Verwaltung. Für die Glücksspielbranche hat das unerwartete Nebenwirkungen. Die CFTC, die Prediction Markets beaufsichtigt, hat weniger als 700 Beschäftigte und derzeit nur eine aktive Kommissarin. Viele Prozesse liegen auf Eis, während Anbieter mit cleveren Umgehungen experimentieren. Polymarket etwa plant trotz Shutdown einen neuen US-Start. Mit einer Bewertung von zwei Milliarden Dollar und Partnerschaften mit der NHL will man vom Sportboom profitieren. Kalshi wiederum meldete im Oktober Rekordvolumen von 4,4 Milliarden Dollar, getrieben vor allem durch Wetten auf NFL- und NBA-Spiele.
Zwischen NBA-Skandal und CFTC-Chaos
Der Zeitpunkt könnte heikler kaum sein: Gerade erst erschütterte ein Wettskandal die NBA – ein Spieler und ein Coach wurden festgenommen, weil sie angeblich Spiele manipuliert haben sollen. Gleichzeitig steigen Prediction Markets in denselben Sportbereich ein, oft ohne dieselben Kontrollmechanismen wie lizenzierte Buchmacher. Während traditionelle Wettanbieter verpflichtet sind, mit Integritätsdiensten und Ermittlern zu kooperieren, fehlt diese Pflicht im neuen Modell. Einige Marktbeobachter sprechen bereits von einer „zweiten Schattenwirtschaft“ des Wettens. Jurist Daniel Wallach warnt:
Diese Unternehmen operieren in einem regulatorischen Vakuum – sie setzen ihre eigenen Regeln, ohne Aufsicht.
Sportwetten 2.0 – oder bloß ein neues Risiko?
Befürworter argumentieren, Prediction Markets könnten transparenter sein als klassische Buchmacher. Durch Blockchain-Technologie seien alle Transaktionen nachvollziehbar, Insiderhandel leichter zu erkennen. „Diese Transparenz ermöglicht Erkennung in Echtzeit – etwas, das klassische Systeme nicht leisten können“, sagt Marcin Kazmierczak, Mitgründer des Blockchain-Dienstes RedStone. Doch Kritiker befürchten, dass genau diese Offenheit den Reiz für Kriminelle steigert. Bei Polymarket etwa wussten Nutzer angeblich schon Stunden vor der Bekanntgabe des Friedensnobelpreisträgers, wer gewinnen würde – und handelten entsprechend. Ob Zufall oder Manipulation – das bleibt offen.
Der Boom der Prediction Markets verändert die Wettlandschaft tiefgreifend. Während Plattformen wie Kalshi und Polymarket Milliardenvolumen bewegen, verlieren klassische Anbieter wie DraftKings und FanDuel an Börsenwert. Manche reagieren, indem sie selbst in den Trend einsteigen – DraftKings kaufte jüngst die Plattform Railbird. In den USA wächst unterdessen der politische Druck. Die NCAA forderte Kalshi kürzlich auf, die Formulierung „Outcome verified by NCAA“ zu ändern, um nicht wie ein offizieller Partner zu wirken. Auch die Sorge um Spielerwetten (Player Props) wächst. Die Grenze zwischen Sportwetten und Finanzspekulation verschwimmt – und mit ihr die Frage, wer künftig Verantwortung trägt.


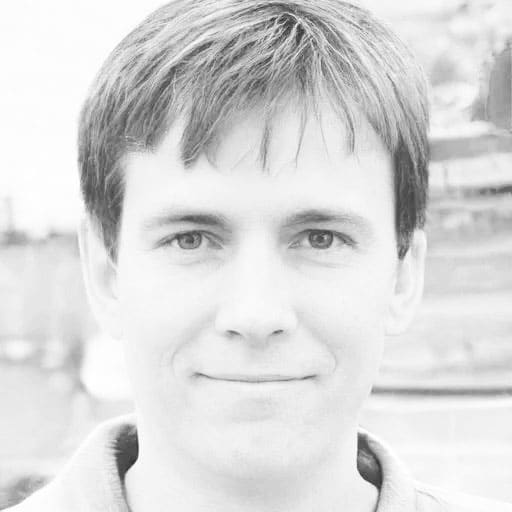



Keine Kommentare vorhanden