- Steuersenkung mit Ansage.
Estlands Regierungskoalition (Reformpartei & Eesti 200) will die Remote-Gambling-Tax jährlich um 0,5 Prozentpunkte senken – Zielmarke: 4 % bis 2029. Damit kehrt Tallinn den 2026 geplanten Anstieg auf 7 % um. - Standortstrategie statt Status quo.
Das Land positioniert sich als Alternative zu Malta für iGaming-Firmen. Man hofft auf Zuzug ausländischer Anbieter und mehr Investitionen. - „Remote gambling paradise“ – so die Befürworter.
Initiator Madis Timpson (Reformpartei) sieht Chancen für Wertschöpfung und neue Steuereinnahmen. Teile der Mehreinnahmen sollen Sport und Kultur finanzieren. - Opposition bremst: Risiko für Staatseinnahmen.
Andrei Korobeinik (Zentrumspartei) warnt vor Einnahmeausfällen und kritisiert: Es fehle belastbare Folgenabschätzung. Für internationale Betreiber zähle Stabilität mehr als Margen. - Regelwerk wird modernisiert.
Nach 15+ Jahren ohne große Anpassungen am Gambling Act plant die Regierung gezielte Aktualisierungen, ohne striktere Auflagen nachzuschieben. - Marktrealität: Wachstum trotz Auflagen.
Studien sehen > €450 Mio. GGR 2025, rund 29 lizenzierte Online-Casinos, CAGR ~3 % bis 2029. Selbstsperren nahmen in fünf Jahren um 36 % zu. - Europäischer Gegenlauf.
Während Länder wie Frankreich, Schweden, Niederlande sowie ggf. UK Steuern erhöhen, geht Estland in die Gegenrichtung – mit offenem Ausgang für Fiskus und Markt.
Kurswechsel in Tallinn: Steuer runter, Hub rauf
Estland will den iGaming-Kurs neu justieren: Die Koalition unter Premier Kristen Michal plant, die Remote-Gambling-Tax in Stufen auf 4 % zu senken – ein klarer Bruch mit dem jüngsten Trend steigender Abgaben in Westeuropa. Hinter dem Entwurf steht Madis Timpson, Vorsitzender des Rechtsausschusses, der ausdrücklich auf internationale Anbieter zielt, die bislang u. a. in Malta sitzen. Timpson wirbt offensiv für das Projekt – und knüpft es an eine Standort-Erzählung samt Sport- und Kulturförderung.
Wir könnten in der Tat zu einem abgelegenen Glücksspielparadies werden.
Parallel verknüpft die Koalition die Reform mit öffentlichen Zielen: Ein Teil künftiger Einnahmen soll Sportinfrastruktur (u. a. eine lange diskutierte Mehrzweckhalle) und Kulturprojekte stützen. Politisch geschickt: Standortpolitik trifft Gemeinwohl-Narrativ – und gibt der Debatte mehr als nur fiskalische Konturen.
Wachstumserzählung vs. Fiskalrisiko
Befürworter argumentieren mit Laffer-Logik light: Ein niedriger Satz ziehe mehr Anbieter an, verbreitere die Basis – und spüle trotz Senkung mehr Geld in den Haushalt. Zusätzlich soll die „Estland-Option“ Planungssicherheit und schnelle Verwaltung bieten – zwei weiche Standortfaktoren, die man explizit gegen Malta und Co. in Stellung bringt.
Die Opposition sieht es anders. Andrei Korobeinik hält die erhofften Zuflüsse ohne evidenzbasierte Analyse für gewagt und verweist auf Erfahrungen anderer Länder, in denen kleine Satzsenkungen den Markt kaum bewegt haben. Für international agierende Operator zählten Rechts- und Steuerstabilität oft mehr als ein paar Basispunkte weniger.
Institutionell wählt Tallinn ein eigenständiges Steuergesetz (außerhalb des Budgets) – ein Signal für Transparenz und Parlamentskontrolle. Zugleich erinnert Ex-Premierin Kaja Kallas daran, dass Werbe- und Verbraucherschutz unlängst bereits verschärft wurden (z. B. Verbot von Celebrity-Ads, „risk-free“ Promos, Jugendschutz).
Marktbild: Daten, Dynamik, Verantwortung
Der regulierte Online-Markt zeigt sich robust: Für 2025 werden > €450 Mio. GGR erwartet; knapp die Hälfte davon aus Online-Casinos. Rund 29 lizenzierte Anbieter bilden ein wettbewerbsintensives Feld aus lokalen Marken (z. B. TonyBet) und internationalen Playern.
Kundenseitig verschiebt sich die Nutzung vom Stationär- zum Online-Spiel – befeuert von Mobile-First, Gamification und bonusgetriebenem Wettbewerb. Zugleich wachsen Schutzmechanismen: > 19.000 Selbstsperren, +36 % in fünf Jahren, unterstreichen das Spannungsfeld aus Wachstum und Verantwortung.
Branchenintern gab es zuletzt Restrukturierungen (z. B. Yolo Entertainment, 280 Stellen in EE auf dem Prüfstand), verbunden mit Markenbündelungen und einer stärkeren Fokussierung auf regulierte Märkte (Nord-Europa, Kanada, Teile des Nahen Ostens). Der estnische Kurs könnte hier als Neuverankerung dienen – oder als Zwischenstopp, je nach finaler Ausgestaltung.
Europäischer Kontext: Gegen den Strom – mit Risiko
Während die Niederlande (weitere Erhöhung 2026), Frankreich, Schweden und wohl Großbritannien an der Steuerschraube drehen, setzt Estland bewusst auf Absenkung. Das verschafft PR-Effekte („pro-business“), erhöht aber auch den Erwartungsdruck: Ohne spürbare Neuansiedlungen kippt die Erzählung schnell.
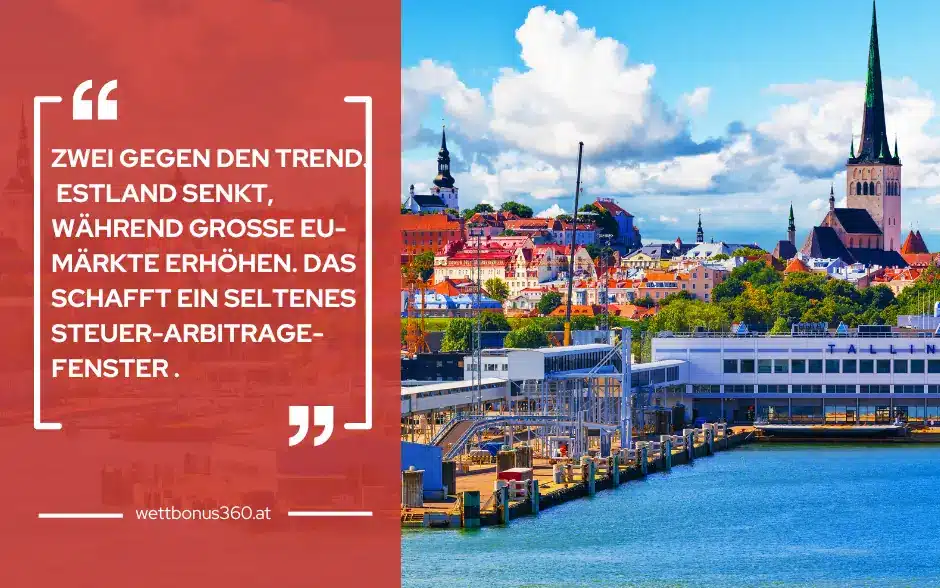
Wesentlich wird die Glaubwürdigkeit der Umsetzung: klare Lizenzprozesse, aufsichtliche Verlässlichkeit, flankierende RG-Standards – und eine sichtbare Mittelverwendung (Sport/Kultur), die politisch trägt. Dazu kommt das Timing: Öffnet Finnland sein Lizenzsystem breiter, könnten Anbieter dorthin schwenken – zulasten Estlands. Kurzum: Tallinn setzt auf eine First-Mover-Story im Baltikum. Ob daraus ein Hub wird, hängt weniger von ein paar Basispunkten als von Stabilität, Geschwindigkeit und Storytelling ab.


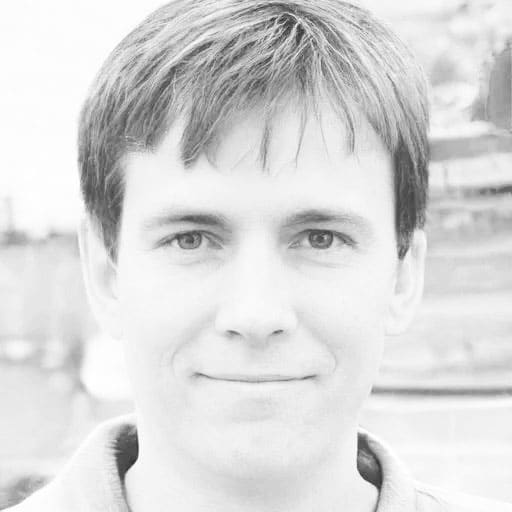



Keine Kommentare vorhanden